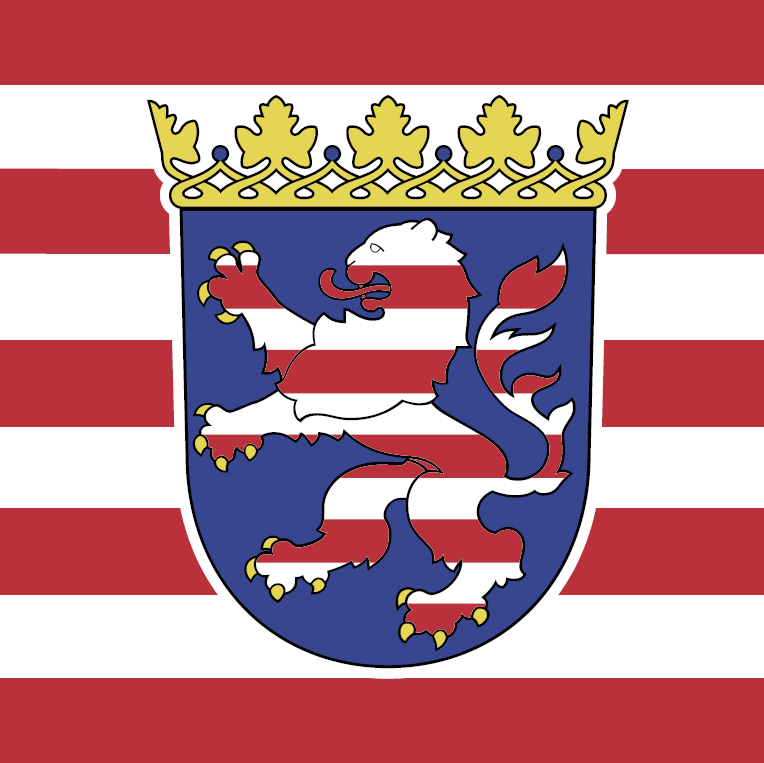Der Mensch ist nur da ganz frei, wo er spielt
Der Freiheitsdrang erwacht bei Kindern schon früh. Sobald sie laufen können, versuchen sie sich dem festen Griff erwachsener Hände zu entwinden: Sie wollen „allein gehen“. Durch kein Gängelband in ihrer Bewegung gehindert, schlagen sie eigene Wege ein, um ihre Umgebung zu erkunden, beäugen Dinge aus der Nähe, fassen sie an, verschieben lose Materialien oder beginnen, damit zu spielen. Spielend erleben sie eine Freiheit, die sie selbstschöpferisch macht. Die Spiele verändern sich, wenn die Kinder größer werden. Es bleibt das Gefühl von Freiheit, das in der Entdeckung der Bewegungsfreiheit, des Allein-Gehen-Könnens seinen Ursprung hat und sich bis in die intellektuellen Lernprozesse des Lesen-, Schreiben- und Rechnenkönnens fortsetzt.
Sich spielerisch zu betätigen, macht Kindern Spaß, auch und gerade wenn damit körperliche und geistige Anstrengungen verbunden sind. Wenn man beobachtet, mit welcher Konzentration Kinder in allen Altersklassen spielen, wie genau sie darauf achten, was sie tun oder zu vermeiden suchen, mit welchem Enthusiasmus sie bei Problemen strategische, lösungsorientierte Überlegungen anstellen und Herausforderungen an ihre Geschicklichkeit, ihre Kombinationskraft und ihre Fantasie begeistert annehmen, sieht man die Früchte, die ihr Freiheitsdrang hervorgebracht hat.
Aber nicht nur Kinder lieben das Spiel. Es ist auch in Kunst und Kultur ein wesentlicher Faktor, der Freiheitsräume eröffnet. Theater, Musik und Literatur erschließen durch spielerische Präsentation Zusammenhänge, die uns mit gesteigerter Intensität hören, sehen und fühlen lassen, was die Menschen emotional umtreibt.
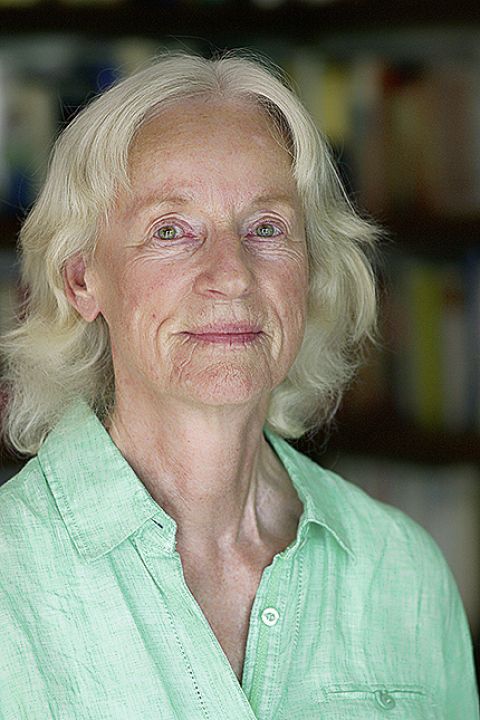
Prof. Dr. Annemarie Pieper
Professorin für Philosophie an der Universität Basel (emer.)
Wir entdecken überraschend neue Perspektiven, die andere Gestaltungsmöglichkeiten unserer Lebenswelt verheißen. Das Spiel holt die Fantasie mit ins Boot, entgrenzt die Vorstellungskraft und befreit von den Routinen der Alltagswirklichkeit. Für Kinder ist dieser Überschuss über die alltäglichen, vielfach durch Gebote und Verbote reglementierten Abläufe ein Anstoß zur Entwicklung ihrer Kreativität. Spielerisch versetzen sie sich in eine andere Welt, in der sie die Akteure sind und lustvoll von ihrer unbeschränkten Freiheit Gebrauch machen. Selbst kleine Kinder spielen hingegeben und selbstvergessen, wenn sie im Sandkasten Objekte formen und sie genüsslich wieder zerstören. Größere Kinder, die mit- und gegeneinander spielen, üben sich nebenher in den Sinn von Spielregeln ein. Dabei lernen sie auch etwas über die Freiheitsrechte der anderen Beteiligten, die sie zu Ehrlichkeit und Fairness verpflichten.
Lesende Kinder tauchen ein in Märchen- und Traumwelten. Mit dichterischer Freiheit können sie die erzählten Geschichten spielerisch verändern, die Hauptfiguren als gut oder böse qualifizieren und sich voller Genugtuung über deren schlimmes Ende freuen. Am meisten bei sich selbst ist ein Kind, das im Geheimen Tagebuch schreibt und dabei in völliger Freiheit seine intimen Gedanken, Erlebnisse und Gefühle zu Papier bringt. Das Spiel mit Wörtern und Ausdrucksformen macht nicht nur sprachkompetent, sondern steigert auch das Selbstbewusstsein.
Prof. Dr. Annemarie Pieper
Professorin für Philosophie an der Universität Basel (emer.)